ZüriCityWalk
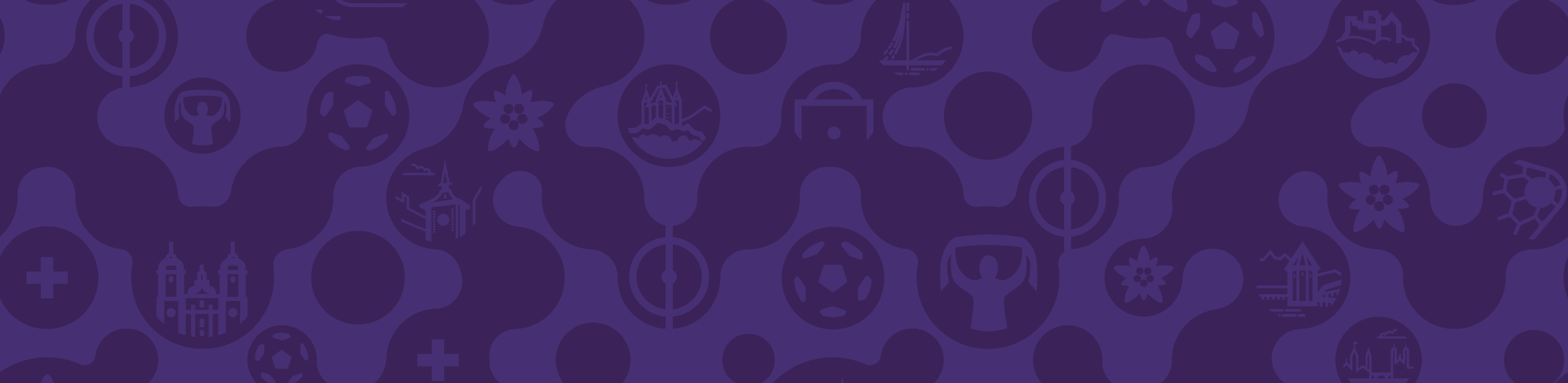
ZüriCityWalk
ZüriCityWalk
ZüriCityWalk
ZüriCityWalk
ZüriCityWalk
ZüriCityWalk
Entdecke Zürich entlang des ZüriCityWalks
Angelehnt an die Linien eines Fussballfelds führt dich der ZüriCityWalk entlang einer violetten Linie durch das Zürcher Stadtzentrum. Lege den Stadtrundgang eigenständig zurück und entdecke einzelne Highlights der Stadt. Startpunkt ist die Trillerpfeife in der Bahnhofstrasse. Auf dem Weg kommst du an neun Stationen vorbei. Hier lernst du starke Frauen kennen, die Zürich geprägt haben.
Entlang des ZüriCityWalks kommst du beim überdimensionalen Matchball bei der Münsterbrücke vorbei. Ein weiterer Selfie-Spot wartet in unmittelbarer Nähe des Rundgangs auf dich: Maddli, das Maskottchen des Turniers, trohnt auf dem Bürkliplatz.
FRANZISKA DOSENBACH (1832–1917)
Unternehmerin und Pionierin des Schweizer Schuhhandels
Franziska Dosenbach, geboren in Kleinwangen als Anna Maria Francisca Buchmann, war eine der ersten Unternehmerinnen der Schweiz. Nach dem frühen Tod ihres Mannes Kaspar Dosenbach im Jahr 1877 übernahm sie die Leitung des gemeinsamen Sattlergeschäfts in Bremgarten (AG) und wandelte es in ein florierendes Schuhunternehmen um. Bereits 1865 begann sie, fabrikgefertigte Schuhe zu verkaufen – eine Innovation in einer Zeit, in der handgefertigte Schuhe dominierten. Trotz anfänglicher Skepsis setzte sie auf Qualität zu erschwinglichen Preisen und traf damit den Nerv der Zeit. Unter ihrer Führung expandierte das Unternehmen: Um 1878 eröffnete sie eine Filiale in Baden, 1880 dann eine weitere am Rennweg in Zürich. Kurz vor ihrem Tod im Jahr 1917 beschäftigte ihr Unternehmen bereits rund 100 Mitarbeitende und besass 17 Liegenschaften.
Franziska Dosenbach, auch bekannt als «Finke Fränzi», gilt als Wegbereiterin für Frauen im Geschäftsleben sowie als Symbol für Innovationsgeist und Durchsetzungsvermögen.
«Ein gutes Paar Schuhe darf kein Luxus sein – sondern Alltag für alle.»
– 1832 Geburt im Luzerner Seetal, Schweiz
– 1853 Heirat mit Kaspar Dosenbach
– 1865: Erster Verkaufsstandort in Bremgarten
– 1878 Eröffnung der Filiale Baden
– 1880 Eröffnung der Filiale am Rennweg, Zürich
– 1890er Expansion: Franziska baut ihr Schuhgeschäft aus und etabliert es als führenden Anbieter von Schuhen in der Schweiz
– 1917 Tod in Bremgarten, Schweiz
Heute Dosenbach ist heute ein bedeutender Anbieter von Schuhen in der Schweiz.
Vor kurzem wurde in Franziskas Heimatort Bremgarten (AG) ein Relief der Stadt übergeben, welches die Familie Dosenbach als Mitgönner im Andenken an Franziska gewidmet hat.
TRUDY STREIT (*1953)
Gründungsmitglied des ersten Frauenfussballvereins der Schweiz
Zufällig in den Fussball verliebt
Trudy Streit, geboren in Zürich, wuchs mit ihrer Schwester Ursula Moser im Stadtteil Unterstrass auf. Beide waren Leichtathletinnen im Leichtathletik-Club Zürich. Beim Training im Letzigrund beobachteten sie die Profifussballer des FC Zürich. Eines Tages rollte ihnen zufällig ein Ball zu, und sie probierten sich im Fussball – eine Leidenschaft wurde geweckt. Am 21. Februar 1968 wurde der Damenfussballclub Zürich gegründet, der erste Schweizer Frauenfussballverein – der monatliche Mitgliedsbeitrag betrug fünf Franken. Trudy und Ursula wurden durch ihre Mitgliedschaft in dem neuen Verein zu Pionierinnen. Mit nur 18 Jahren wurde Ursula die erste Präsidentin.
Trudy war ein Ausnahmetalent und mit 17 Jahren bereits Nationalspielerin. Sie nahm am ersten offiziellen Länderspiel der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft teil und erlebte die Herausforderungen des frühen Frauenfussballs, wie das eigenhändige Aufnähen des Schweizerkreuzes auf die Trikots. Trotz anfänglicher Vorurteile und fehlender Anerkennung kämpfte Trudy für die Gleichberechtigung im Fussball. Es ist Frauen wie Trudy Streit zu verdanken, dass dem Frauenfussball in der Schweiz der Weg geebnet wurde und ihre Enkelin nun spielt, ohne dafür belächelt zu werden.
«Mädchen zwischen 9–99 gesucht. Meldet euch!», Zeitungsinserat des Damenfussballclubs Zürich, 1968
– 1953 Geburt in Zürich, Schweiz
– 1968 Gründung des Damenfussballclubs Zürich mit ihrer Schwester Ursula Moser
– 1970 Trudy wird Nationalspielerin – Einsatz beim ersten Frauenländerspiel auf Schweizer Boden im Stadion Breite in Schaffhausen: Schweiz besiegt Österreich mit 9:0
ANNEMARIE HUBACHER-CONSTAM (1921–2012)
Prägende Architektin Zürichs, Pionierin in einer Männerdomäne
Annemarie Hubacher-Constam wuchs in einem architektonisch geprägten Umfeld auf. Ihr Grossvater Gustav Gull, Architekt des Schweizerischen Landesmuseums, ermutigte sie, Architektur zu studieren. 1943 schloss sie das Studium an der ETH Zürich ab. Zwei Jahre später gründete sie mit ihrem Mann Hans Otto Hubacher ein eigenes Architekturbüro. Bekannt wurde sie 1958 als Chefarchitektin der zweiten Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA). Gemeinsam mit über 60 Architektinnen und Grafikerinnen gestaltete sie diese Leistungsschau der Schweizer Frauen, die zum Symbol weiblicher Schaffenskraft wurde. Neben ihrer architektonischen Tätigkeit engagierte sich Annemarie sozial und politisch: Sie war Mitglied der Fürsorgekommission der Stadt Zürich und im Vorstand des Schweizer Heimatschutzes. 1996 wurde sie von der Stadt Zürich für ihren Einsatz für die Rechte der Frauen ausgezeichnet – fünf Jahre nach dem Frauenstreik von 1991.
Ihr Werk prägt das Stadtbild Zürichs wesentlich. Zu Annemaries bedeutendsten Bauten zählen das Strandbad Mythenquai (1954), die Primarschule Hofacker (1955), die Reformierte Kirche Zollikerberg (1960), die Wohnsiedlung Rietholz (1961), die Friedhofskapelle Eichbühl (1964), das Hotel Atlantis (1970), die Gewächshäuser des Botanischen Gartens (1977) und der Umbau des Völkerkundemuseums Zürich (1980).
«Für einmal stehen nicht die Frauen im Hintergrund …»
– 1921 Geburt in Zürich, Schweiz
– 1943 Abschluss des Architekturstudiums an der ETH Zürich
– 1945 Gründung ihres Architekturbüros mit ihrem Mann Hans Otto
– 1958 Nationale Bekanntheit als Chefarchitektin der zweiten Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA)
– 1991 Teilnahme und Engagement im Zusammenhang mit dem Frauenstreik am 14. Juni
– 1996 Ehrung durch die Stadt Zürich für ihren Einsatz für die Rechte der Frauen
– 2012 Tod in Küsnacht ZH, Schweiz
MILEVA MARIC (1875–1948)
Pionierin der Wissenschaft – im Schatten Einsteins
Die Serbin Mileva Maric war eine der ersten Frauen, die am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich Mathematik und Physik studierten. Dort traf sie Albert Einstein. Die beiden diskutierten o. über wissenschaftliche Fragen und heirateten schliesslich 1903. Mileva galt als aussergewöhnlich begabt. Viele Historiker*innen vermuten, dass sie bei Einsteins frühen Arbeiten mitgeholfen hat – etwa bei der Relativitätstheorie. Ob und wie viel sie beigetragen hat, ist bis heute nicht eindeutig belegt. Klar ist aber: Sie war eine Frau mit grossem mathematischem Talent in einer Zeit, in der Frauen in der Forschung kaum anerkannt wurden.
Nach der Trennung von Einstein im Jahr 1914 zog sie ihre zwei Söhne allein gross. Ihr jüngerer Sohn litt an Schizophrenie, und sie kümmerte sich bis zu ihrem Tod um ihn. Mileva kämpfte ihr Leben lang mit finanziellen Sorgen, blieb aber stark und engagiert. Heute wird Mileva Maric als wichtige Persönlichkeit in der Geschichte der Wissenschaft gewürdigt – eine Frau, die viel zu lange übersehen wurde.
«Ich brauche meine Frau, sie löst alle meine mathematischen Probleme.» – Albert Einstein
– 1875 Geburt in Titel, Serbien
– 1896 Umzug in die Schweiz, um am Polytechnikum in Zürich zu studieren
– 1901 Beginn der engen wissenschaftlichen und persönlichen Partnerschaft mit Albert Einstein
– 1903 Heirat mit Albert Einstein
– 1904 Geburt ihres ersten Sohnes, Hans Albert Einstein
– 1914 Trennung von Albert Einstein und spätere Scheidung (1919)
– 1948 Tod in Zürich, Schweiz
MARIE HEIM-VÖGTLIN (1845–1916)
Erste Ärztin der Schweiz
Mit Erlaubnis von Vater und Ehemann
1868 wurde Marie Heim-Vögtlin als erste Schweizerin zum Studium an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich zugelassen. Landesweit brach ein Sturm der Entrüstung aus. Die Öffentlichkeit war damals der Ansicht, dass das weibliche Geschlecht körperlich zu schwach sei, ein Studium in Humanmedizin zu absolvieren. Ihr Vater förderte Maries Bildung, die sowohl für die Immatrikulation als auch für die spätere Niederlassung als Gynäkologin dessen schriftliche Erlaubnis und Unterstützung benötigte. 1875 heiratete Marie den Geologen Albert Heim. Auch er musste seiner Frau ausdrücklich die Erlaubnis zum Arbeiten geben – so wie es das Gesetz damals festlegte. Die beiden führten mit ihren drei Kindern eine Ehe, für die es noch keine Vorbilder gab: Sowohl Albert als auch Marie waren in anspruchsvollen Berufen tätig. Damit gehörte Marie zu den ersten Frauen, die sich um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bemühten. Marie Heim-Vögtlin war sich ihrer Rolle als Vorreiterin bewusst und unterstützte die Frauenbewegung. Sie förderte ausserdem mit Publikationen und Vorträgen das Gesundheitswesen. Zeitlebens genoss sie den Ruf einer hervorragenden Ärztin und war bekannt dafür, auch sozial schwächere Patientinnen für einen symbolischen Betrag zu behandeln. 1916, im Alter von 71 Jahren, starb Marie in Zürich, nachdem sie vier Jahre zuvor an Lungentuberkulose erkrankt war.
«Ich wollte mehr als nur Mutter und Ehefrau sein.»
– 1845 Geburt in Windisch, Schweiz
– 1868 Erste Schweizerin, die ein Medizinstudium beginnt
– 1874 Abschluss als Ärztin, Eröffnung einer gynäkologischen Praxis
– 1875 Heirat mit Albert Heim, Geburt des ersten Kindes
– 1890 Engagement für die Frauenbewegung und Gesundheitsaufklärung
– 1912 Erkrankung an Lungentuberkulose
– 1916 Tod in Zürich, Schweiz
KATHARINA VON ZIMMERN (1478–1547)
Zürichs letzte Äbtissin
Die Äbtissin, die Zürich veränderte
1478 in Messkirch geboren, kam Katharina 1488 mit ihrer Familie an den Walensee. Drei Jahre später brachte ihr Vater sie und ihre Schwester nach Zürich, wo sie in die Abtei Fraumünster aufgenommen wurden. Mit nur 18 Jahren wurde Katharina zur Äbtissin gewählt. Sie leitete die reiche Abtei während 28 Jahren mit Umsicht, wirtschaftlichem Geschick und diplomatischem Takt. Als Stadtherrin übernahm sie repräsentative Aufgaben und führte die Geschäfte der Abtei souverän. Ab 1519 predigte Ulrich Zwingli jeden Freitag auf dem Münsterhof-Markt mitten im Marktgeschehen. Katharina gewährte ihm für seine Predigten Raum im Fraumünster und trug so zur Verbreitung der Reformation bei. 1524 traf sie eine historische Entscheidung: Sie übergab das Fraumünster freiwillig an den Rat der Stadt Zürich – ohne Revolte und mit einer friedlich geregelten Schlüsselübergabe. Als Anerkennung erhielt sie eine Leibrente und Wohnrecht im ehemaligen Kloster. Katharina galt als gebildete Humanistin, geschickte Bauherrin und kluge Vermittlerin. Dank ihrer Weitsicht verlief die Reformation in Zürich ohne Gewalt – sie bewahrte die Stadt, in ihren eigenen Worten, vor «Unglück und Ungemach».
– 1478 Geburt in Messkirch, Deutschland
– 1488 Katharina kommt aus Süddeutschland in die Schweiz
– 1491 Eintritt in das Fraumünsterkloster in Zürich
– 1496–1524 Äbtissin und Stadtherrin von Zürich, Förderin von Kunst und Kultur
– 1524 Übergabe der Abtei an den Rat der Stadt Zürich
– 1547 Tod in Zürich, Schweiz
EMILIE LIEBERHERR (1924–2011)
Stadträtin, Ständerätin und Kämpferin für Frauenrechte
Emilie Lieberherr war eine Pionierin der Schweizer Politik und Frauenbewegung. Lieberherr war die erste Urnerin mit einer Matura, Doktorin der Ökonomie, Kindermädchen bei Jane und Peter Fonda, erste Konsumentenschützerin der Schweiz und offen homosexuell. Ihr Leben lang setzte sich Emilie für Frauenrechte und soziale Gerechtigkeit ein. 1969 erlangte sie schweizweite Bekanntheit als Mitorganisatorin des Marsches nach Bern, bei dem tausende Frauen das Frauenstimmrecht forderten – ein Wendepunkt in der politischen Geschichte der Schweiz.
«Wir stehen hier nicht als Bittende, sondern als Fordernde.»
1970 wurde sie als erste Frau in den Zürcher Stadtrat gewählt. In ihrer Rolle als Sozialvorsteherin setzte sie sich unermüdlich für Kinderbetreuung, Altersversorgung und die Rechte von Frauen ein und war eine prägende Figur der kontrollierten Heroin-Abgabe in Zürich sowie der Drogenliberalisierung generell.
Im Jahr 1978 wurde Lieberherr dann in den Ständerat gewählt – wiederum als eine der ersten Frauen. Ihre Stimme hatte Gewicht, nicht nur für Gleichstellungsthemen, sondern auch in der Sozial- und Bildungspolitik. Emilie Lieberherr blieb bis zu ihrem Rücktritt als Stadträtin 1994 eine der prägenden Figuren der Schweizer Politik.
– 1924 Geburt in Erstfeld, Schweiz
– 1961 Mitbegründerin des Konsumentinnenforums Schweiz
– 1969 Präsidentin des Aktionskomitees für den Marsch nach Bern
– 1970–1994 Erste Stadträtin in Zürich
– 1976–1980 Erste Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen
– 1978–1983 Ständerätin des Kantons Zürich
– 2011 Tod in Zollikerberg, Schweiz
ANNEMARIE SCHWARZENBACH (1908–1942)
Schriftstellerin, Reisejournalistin und Kultfigur
Ein Leben zwischen Aufbruch und Abgrund
Annemarie Schwarzenbach war Schriftstellerin, Journalistin, Fotografin und Abenteurerin. Sie wuchs in einer wohlhabenden Zürcher Industriellenfamilie auf. Früh interessierte sie sich für Literatur und Politik. Nach dem Geschichtsstudium in Paris und Zürich zog es sie in die Welt. 1931 hielt sie sich in Berlin sowie im Umfeld von Klaus und Erika Mann in München auf. Ihre antifaschistische Haltung führte zu Konflikten in der Familie, da einige Angehörige das NS-Regime unterstützten. Nach 1933 reiste sie fast pausenlos – als Journalistin berichtete sie aus Spanien, Russland, Persien und den USA. 1939 durchquerte sie mit der Forscherin Ella Maillart Afghanistan. Ihre Texte und Fotos zeugen von einem scharfen Blick für politische und gesellschaftliche Umbrüche. 1935 heiratete sie in Persien den französischen Diplomaten Claude-Achille Clarac. Beide waren homosexuell, und ihre Beziehung war ein Arrangement. Annemarie kämpfte zugleich mit Depressionen und Morphiumsucht. In nur wenigen Jahren schrieb sie drei literarische Werke und rund 300 journalistische Texte. Ihre Reportagen erschienen in Schweizer Zeitungen und als Bücher. 1942 verunglückte Annemarie mit dem Fahrrad und starb mit nur 34 Jahren.
Ihre ungewöhnliche Lebensgeschichte und ihr androgynes Erscheinungsbild machten sie postum zur Kultfigur – bis heute gilt sie als Symbol für Unangepasstheit, künstlerische Freiheit und mutiges Denken.
«Ich will die Freiheit, das zu sein, was ich bin – und nicht, was andere aus mir machen wollen.»
– 1908 Geburt in Zürich, Schweiz
– 1931 Veröffentlichung ihres ersten Romans «Freunde um Bernhard»
– 1933 Beginn ihrer Reisen in den Nahen Osten und nach Persien
– 1939 Expedition mit Ella Maillart von der Schweiz nach Afghanistan
– 1940 Aufenthalt in den USA und Arbeit als Journalistin
– 1942 Tod in Sils, Schweiz, nach einem Fahrradunfall
TATJANA HAENNI (*1966)
Einflussreiche Schweizer Fussball-Funktionärin
Internationale Expertin und Förderin des Frauenfussballs
1979, im Alter von nur 12 Jahren, begann Tatjana Haennis bemerkenswerte Laufbahn als Fussballerin in Bern. Ihr Talent brachte sie an 23 Länderspiele für das Schweizer Nationalteam. Nach ihrer Zeit als aktive Spielerin wurde der Frauenfussball für sie zur Lebensaufgabe. Tatjana zählt zu den einflussreichsten Figuren im Schweizer Frauenfussball: Sie war die erste Mitarbeiterin der UEFA, die sich ausschliesslich um den Frauenfussball kümmerte. Ab 1999 arbeitete sie dann 18 Jahre lang bei der FIFA und spielte eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des internationalen Frauenfussballs. Von 2018 bis 2022 war Tatjana beim Schweizerischen Fussballverband tätig. Sie begann dort als Ressortleiterin Frauenfussball, wurde dann aber 2020 Direktorin für den Bereich Frauenfussball und damit die erste sowie einzige Frau in der Geschäftsleitung. Drei Jahre später wagte sie den Sprung über den Atlantik und ist heute Direktorin der National Women’s Soccer League in den USA. Tatjana hat sich international einen Namen als herausragende Persönlichkeit im Frauensport gemacht. Es ist nicht zuletzt ihr, ihrer Vision und ihrem Durchhaltevermögen zu verdanken, dass die Schweiz Gastgeberin der UEFA Women’s EURO 2025 ist.
«Vor mir hat es schon Pionierinnen gegeben, nur kennt man sie nicht. Ich führe fort, was Frauen vor mir geleistet haben.»
– 1966 Geburt in Biel, Schweiz
– 1979–1996 Aktive Fussballkarriere
– 1994–1999 UEFA, verantwortlich für Frauenwettbewerbe
– 1999–2017 FIFA, Leiterin der Frauenfussballabteilung, zuständig für die Organisation von FIFA-Frauen-Weltmeisterschaften
– 2018–2022 Direktorin Frauenfussball beim Schweizerischen Fussballverband, erstes weibliches Mitglied der SFV-Geschäftsleitung
– Seit 2023 Sportdirektorin der National Women’s Soccer League in den USA